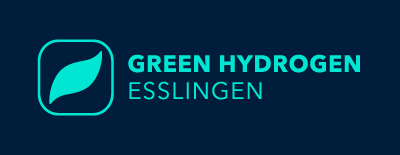Abwärmenutzung bei der Wasserstofferzeugung stärkt Effizienz und Klimaschutz.
Die Erzeugung von Wasserstoff ist energieintensiv. Die Energieverluste bei der Elektrolyse treten in Form von Abwärme zutage. Es ist eine noch zu oft verkannte und ungenutzte Energiequelle der Wasserstoffproduktion. Dabei handelt es sich um wertvolle Wärmeenergie, welche die Effizienz der Gesamtanlage steigert.
Verbesserter Wirkungsgrad.
Der Wirkungsgrad der Elektrolyse liegt je nach Technologie bei 60 bis 70 %. Das bedeutet, dass 30 bis 40 % der eingesetzten elektrischen Energie als Abwärme verloren gehen. Durch eine gezielte Nutzung dieser Abwärme wird der Gesamtwirkungsgrad also erheblich gesteigert. Das macht Wasserstoffprojekte wirtschaftlicher und nachhaltiger.
Nebenprodukt Abwärme: Ein entscheidender Kostenfaktor.
In der Energieversorgung von großen Gebäuden, Unternehmen und ganzen Quartieren spielen die Kosten für Heizwärme oder industrielle Prozesswärme eine große Rolle. Wird Wasserstoff in der Nähe erzeugt, liegt die Nutzung der dabei anfallenden Abwärme im Nahwärmenetz auf der Hand. Schließlich senkt es die Wärmekosten und verbessert gleichzeitig die Umweltbilanz. Es unterstützt somit auch die Sektorenkopplung und fördert den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft.
Beispiele:
- Eine 10-MW-Elektrolyseanlage erzeugt neben Wasserstoff etwa 3 bis 4 MW nutzbare Abwärme.
- Diese Wärme kann für Fernwärmenetze bzw. Nahwärmeversorgung, industrielle Prozesse oder die Beheizung von Gebäuden verwendet werden.
- Unternehmen, die Abwärme effizient integrieren, können ihre Betriebskosten senken und eine zusätzliche Einnahmequelle durch Wärmeverkauf erschließen.
Das Potenzial der Abwärmenutzung.
Die Abwärmenutzung kann nicht nur als Unterstützung zur Wärmeerzeugung dienen, sondern in manchen Fällen eine vollständige Heizlösung darstellen.
- In Passivhäusern oder modernen, gut gedämmten Gebäuden kann die Abwärme aus einer nahegelegenen Elektrolyseanlage die komplette Wärmeversorgung decken.
- Fernwärmenetze können mit der Abwärme gespeist werden, um fossile Brennstoffe in der Wärmeversorgung zu ersetzen.
- Industrieprozesse, die Niedertemperaturwärme (z. B. 60 bis 80°C) benötigen, profitieren besonders stark von der direkten Nutzung der Abwärme.
Ausblick: Kraft-Wärme-Kopplung mit Wasserstoff.
Die Kombination aus Wasserstoff und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wie einem Blockheizkraftwerk (BHKW) oder einer Brennstoffzelle (BZ) bietet eine hocheffiziente Möglichkeit, gleichzeitig Strom und Wärme zu erzeugen.
- Höherer Wirkungsgrad: mit Wasserstoff betriebene KWK-Anlagen erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von über 80 %.
- Reduktion fossiler Brennstoffe: Durch die Nutzung von grünem Wasserstoff kann der Einsatz fossiler Energieträger minimiert werden.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Von Quartierslösungen bis hin zu industriellen Anwendungen ersetzen mit Wasserstoff betriebene KWK-Anlagen verschiedene fossile Systeme.
- Integration erneuerbarer Energien: Wasserstoff-BHKW oder -BZ können mit Wind- und Solarstrom gekoppelt werden, um eine nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten. Diese Kombination aus power-to-gas-to-power könnte ein wichtiger Bestandteil des künftigen Stromsystems sein. Stromspitzen aus EE können somit in Form von Wasserstoff gespeichert werden und während Dunkelflauten mittels KWK rückverstromt werden.
Das Projekt in Esslingen: Abwärmenutzung und Wasserstoff-BHKW in der Praxis.
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung ist das Klimaquartier in Esslingen, wo Wasserstoff und Abwärmenutzung intelligent kombiniert werden. Die vor Ort erzeugte Abwärme der Elektrolyse wird in das Wärmesystem des Quartiers eingespeist und trägt zur Beheizung von Wohngebäuden bei. Rund 30 % des eingesetzten grünen Stroms fallen hier als Abwärme an. Dies verbessert nicht nur den Wirkungsgrad des gesamten Systems, sondern reduziert auch den restlichen Wärmebedarf im lokalen Nahwärmenetz, an das 450 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen sowie Gebäude der Hochschule Esslingen angeschlossen sind. Im Esslingen-Projekt wird die Wärmeversorgung durch insgesamt fünf Blockheizkraftwerke und fünf Gas-Spitzenlastkessel sichergestellt, die jeweils in den einzelnen Wohn- und Geschäftsgebäuden untergebracht sind und mit 100 % Ökogas von Polarstern betrieben werden.
Fazit.
Die Nutzung der Abwärme aus der Wasserstofferzeugung bietet enormes Potenzial für die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit von Elektrolyseanlagen. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu senken, fossile Brennstoffe in der Wärmeversorgung zu ersetzen und die Nachhaltigkeit von Wasserstoffprojekten zu erhöhen. Die Verbindung von Wasserstoffproduktion und Abwärmenutzung unterstützt langfristig die sektorenübergreifende Dekarbonisierung der Energieversorgung.